
Wiki / Paracelsus
*10. November 1493 in Einsiedeln, Schweiz
24. September 1541 † in Salzburg, Österreich
Inhaltsverzeichnis: (verbergen)
 Paracelsus-Denkmal, Beratzhausen, Oberpfalz |
|
Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, der sich später Paracelsus nannte, wird in den Wintermonaten des Jahres 1493 als Sohn des Wilhelm Bombast von Hohenheim und einer namentlich unbekannten Mutter gebo-
Drei wesentliche Einflüsse prägen die Jugend des Paracelsus:
|
|
Um 1502 lassen sich Wilhelm und sein Sohn im Kärntner Städtchen Villach nieder. Von der Mutter sind seither keine Dokumente überliefert; möglicherweise wurde der Umzug nach Villach durch den Tod der Mutter motiviert, und/oder |
Paracelsus verlässt Villach, um Medizin zu studieren – in verschiedenen deutschen Städten wie Tübingen, Heidelberg, Mainz, Frankfurt und Köln, wo er allerdings mit der Qualität der Lehre unzufrieden ist:
1515 beendet er sein Studium im italienischen Ferrara und promoviert mit zweiundzwanzig Jahren zum "Doktor beider Arz-
neien", der inneren Medizin und der Chirurgie, was ihm das Recht verleiht, den roten Talar als Zeichen seiner Doktorwürde
tragen zu dürfen; Diplome wurden damals keine vergeben.
|
Der frischgebackene Doktor der Medizin macht sich auf zu einer großen Wanderung quer durch Europa. Der folgt damit der Tradition der Handwerksburschen, die nach abgeschlossener Lehre auf die Walz gehen, um erste berufliche Erfahrungen zu sammeln.
Auch wenn die Reiseroute heute nicht mehr gesichert rekonstruiert werden kann, da nicht viele Dokumente zur Verfügung stehen, so kann man doch davon ausgehen, dass Paracelsus fast ganz Europa bereist hat: Von Italien gelangt er über Südfrankreich nach Spanien. Nach einem Abstecher mit einem Heerzug nach Nordafrika geht es in den Norden nach Portugal, Paris, England, Schottland, dann nach Dänemark und Schweden bis Moskau. Moskau wird vom Reitervolk
Auf seinen Reisen sammelt Paracelsus aus allen ihm zugänglichen Quellen ein vielfältiges und profundes Wissen über die europäische Medizin seiner Zeit: "Nicht allein bei den Doktoren, sondern auch bei den Scherern, Badern, gelernten Ärzten, Weibern, Schwarzkünstlern, so sich dess' pflegen, bei den Alchemisten, bei den Klöstern, bei den Edlen und Unedlen, bei den Gescheiten und Einfältigen."
Es ist möglich, dass er in Portugal, damals das Zentrum von Entdeckerfahrten und Handelshafen in die Neue und Alte Welt, mit nordamerikanischen Indianern in Kontakt kam, auch mit Afrikanern und mit Indern, deren ausgeklügeltes medizi- |
|
Salzburg: Nach langer Wanderzeit scheint Paracelsus, nun etwas über dreißig Jahre alt, das Bedürfnis nach Sesshaftigkeit zu verspüren. So lässt er sich 1524 in Salzburg nieder, wo er allerdings bald in Konflikt mit der Obrigkeit und vor allem dem Klerus kommt, da er mit den aufständischen Bauern sympathisierte und die Kirche heftig angriff, wie er selbst in einer Kampfschrift jener Zeit schreibt: "So ich etwan und etliche Male in Tabernen, Krügen und Wirtshäusern wider das unnütze Kirchengehen, üppige Feiern, vergebene Beten und Fasten, Almosengeben, Opfern, Zehnten, Leibfall, Dreißigsten, Jahrzeit, Beichten, Sakrament nehmen und alle andere dergleichen priesterliche Gebot und Aufenthaltung geredet habe."
Er muss aus Salzburg fliehen.
Straßburg: Daraufhin kommt er nach Straßburg, wo er das Bürgerrecht erwirbt, ein Haus kauft und der angesehenen Zunft "zur Lutzer-
Basel: Im Jahr 1527 nimmt Paracelsus den Ruf nach Basel an, wo ihm eine Stellung als Stadtarzt und Dozent der Medizin an der Uni-
Als Dozent revolutioniert Paracelsus den Medizinunterricht, und nach kurzer Zeit erhöht sich die Zahl der Medizinstudenten von 5 auf 31:
In seiner Funktion als Stadtarzt obliegt Paracelsus auch die Oberaufsicht über die Apotheken, deren Praktiken er heftig kritisiert. Es war zu jener Zeit nicht ungewöhnlich, dass Ärzte gleichzeitig Apotheker waren, und ihren Patienten in zahl-
Die Situation wird kritisch für Paracelsus. Als dann noch ein Rechtsstreit um ein unbeglichenes Honorar eines Patienten entsteht, muss er im Frühjahr 1528 Hals über Kopf fliehen und seine ganze Habe zurück lassen. |
|
Nach dieser Episode schien Paracelsus die Idee der Sesshaftigkeit immer mehr aufgegeben zu haben. Er bezeichnete die Ereignisse in Basel als eine entscheidende Wende seines Lebens, durch die alle Hoffnung auf ein gewöhnliches, angepass-
 Wunderbare Errettung eines ertrunkenen Knaben aus Bregenz Albrecht Dürer (1471-1528) deutscher Maler, Grafiker, ~1490-1493 Er reiste von Basel durch das Elsass, wo er gemäß Aussage seines Basler Famulus Oporinus "wie ein Äskulap verehrt wur-
Er verließ Nürnberg um 1529 und ließ bei seinem Drucker eine dritte Schrift über Syphilis zurück, in der Annahme, sie würde ebenfalls gedruckt und fände gute Aufnahme. Kurz danach schon erreichte ihn die schlechte Nachricht, dass sein Buch nicht ge-
1531 traf er in St. Gallen ein, wo er auf die Unterstützung des Bürgermeisters, Reformators und Humanisten Joachim von Watt, genannt Vadianus, hoffte; möglicherweise nahm Paracelsus an, dass Vadianus, selbst Arzt von Beruf, ihn unterstützen würde. So beendete Paracelsus in St. Gallen sein Opus Paramirum, das die konzentrierte Essenz all seiner Anschauun- |
|
Burnout: Paracelsus war nun in der Lebensmitte angekommen, knapp vierzig Jahre alt, Zeit seines Lebens ein Wanderer und Forscher, oft enttäuscht von seinen Zeitgenossen, immer weiterstrebend, häufig in Konflikt mit der Umwelt, und wohl auch des unablässigen Kämpfens und Arbeitens müde geworden.
Reorientierung: 1531 nahm sein Leben eine neue Richtung; vielleicht unter anderem auch aufgrund mehrerer bedeut-
Wanderprediger: Es war eine Zeit der Besinnung und die Frage nach dem Sinn des Lebens stellte sich. Paracelsus nahm diese Herausforderung in der ihm eigenen Art an. Als bettelarmer und zerlumpter Wanderprediger begab er sich in
Paracelsus' ärztliche Tätigkeit nahm aber bald wieder überhand; viele Kranke und Gebrechliche kamen zu ihm, dem Wun-
Paracelsus verließ das Appenzellerland und wanderte weiter zu verschiedenen Bergwerken in Österreich, wo er die Ar- |
|
In seinen letzten Lebensjahren kamen sowohl die Person des Paracelsus wie auch sein Werk zur Reife. Er veröffentlichte in Augsburg die ersten beiden Bände seiner »Wundarznei«, die dank ihrer populärwissenschaftlich gehaltenen Sprache sehr viel Anklang fanden und deren erste Auflage schon nach wenigen Monaten vergriffen war.  Die von ihm zuvor geplanten Bände III, IV und V der Wundarznei blieben un-
Bei einem längeren Aufenthalt 1539 bei Johann von Lepnick, dem obersten
Paracelsus hatte seine Lebensaufgabe erfüllt. Schon im relativ jungen Alter von noch nicht einmal fünfzig Jahren erscheint er auf aktuellen Portraits mit einem alten und verlebten Gesicht, doch immer mit klaren und seelenvollen Augen. Er stirbt im Jahre 1541 in Salzburg. Über die Todesursache gibt es eine Reihe von Spekulationen:
Eine Exhumierung seiner Leiche hat tatsächlich eine noch frische Wunde am Schädel des Paracelsus gezeigt, so dass die zweite oder dritte Möglichkeit eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich in Anspruch nehmen können. |
|
Übereinstimmend mit allen alten Kulturen unterschied Paracelsus drei große Lebensbereiche, von denen einer den anderen gebiert. Er nannte sie:
Paracelsus Weltenmodell, das aus drei unterschiedlichen Stufen besteht, die im Göttlichen münden, wird so umschrieben: Der Geist ist der Herr, die Imagination das Werkzeug und der Körper der bildsame Stoff.
Die Vorstellungskraft, das Seelische, dient dem Geist als Werkzeug, das auf den physischen Körper einwirkt mit Denken, Fühlen und Empfinden als Ausdruck. |
Persönliche Bekenntnisse
Aufruf
Einsicht
Es gibt keine schädlichen Stoffe, es gibt nur schädliche Dosierungen. Alles, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen.
Siehe auch: Gesetz 3:1
Alternative Version: "Die Sterne zwingen uns zu nichts, sie verleiten uns auch zu nichts."
Absage an Schicksalsgläubigkeit und Determinismus
Entsprechung zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos
Verkürzte Version: "Wo Gift ist, dort ist Tugend."
Jolande Jacobi, Herausgeberin, Norbert Guterman, Übersetzer, Lebendiges Erbe. Eine Auslese aus seinen sämtlichen Schriften, S. 124, Rascher Verlag, Zürich und Leipzig, 1942
|
|
|
Appeal
Conclusion
"The dose makes the poison." ◊ Latin: "Sola dosis facit venenum."
Paracelsus attended seven prestigious universities.
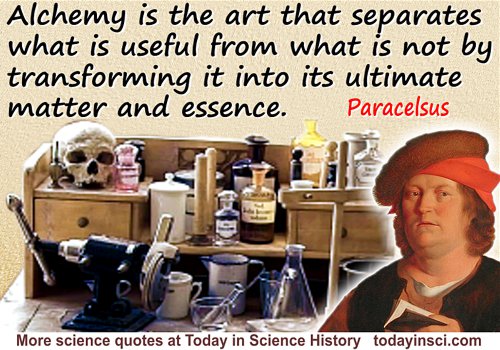
|
|
Recommendations
|
|
Links zum Thema Paracelsus und sein WerkLiteratur
Biographie, Texte, Ausblick
Über Paracelsus' Medizin, Philosophie, Astrologie, Alchemie und Therapiekonzepte, reich bebildert
Literature (engl.)
Externe Weblinks
External web links (engl.)
Audio and video links (engl.) |
Hawkins